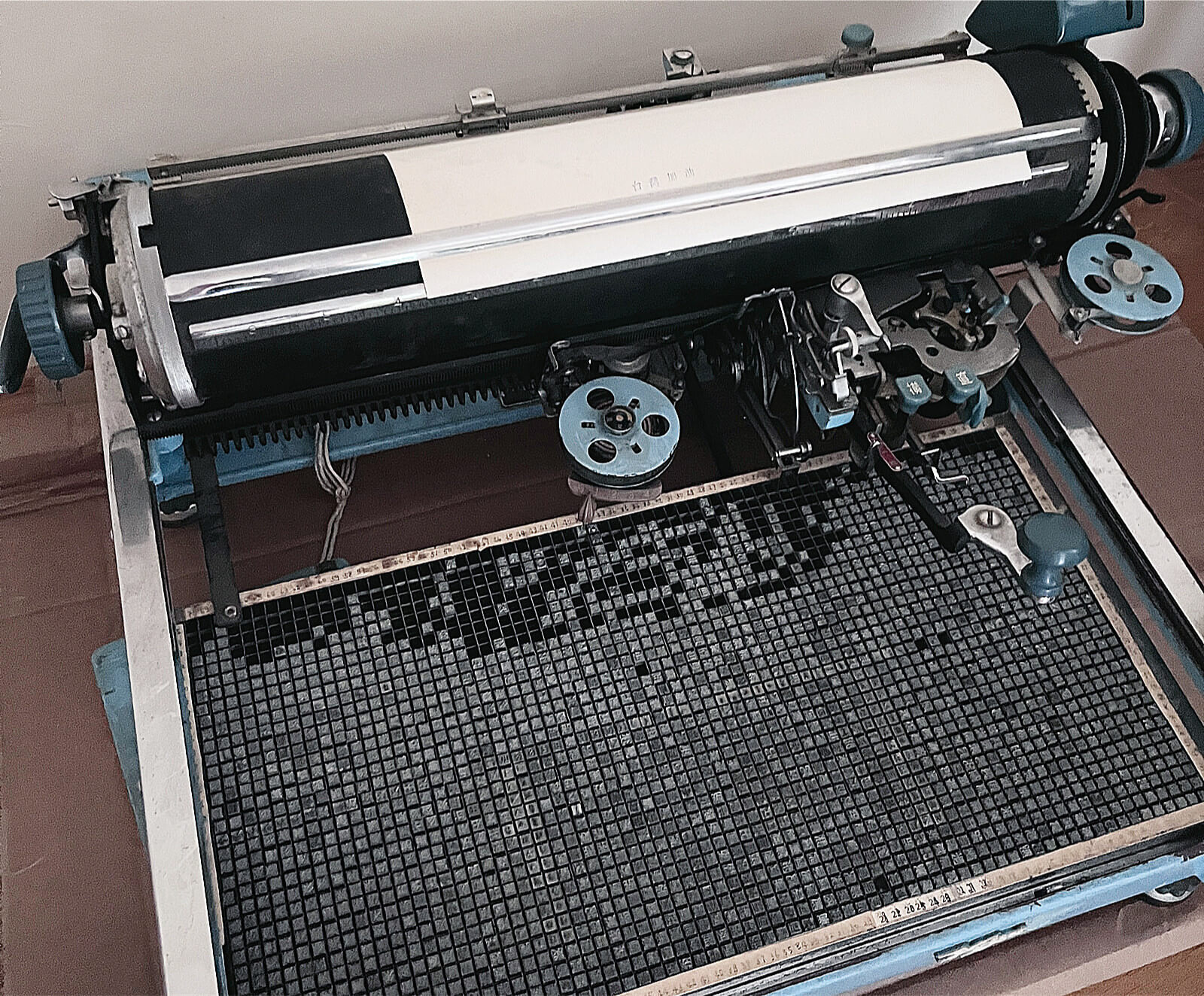Spazierend Wien dekolonialisieren

Die Künstlerin Carla Bobadilla bietet in ihren Wien-Führungen eine Auseinandersetzung mit dem vermeintlich Bekannten.
Es ist ein geschäftiger Tag in der Wiener Innenstadt. Menschen mit eingefrorenen Minen und schnellen Schritten sind auf ihren Wegen von A nach B. Der Tag ist kalt und grau. Eine kleine Frau mit großer Brille und wachen Augen wartet auf den Beginn eines Stadtspaziergangs. Carla Bobadilla ist bildende Künstlerin, Mitgründerin des Kollektivs „Decolonizing in Vienna“ und unterrichtet an der Universität für Angewandte Kunst und an der Uni Wien.
In Österreich hat sie erlebt, dass viele koloniale Zusammenhänge nicht für alle Menschen klar ersichtlich sind. Auch für Bobadilla, geboren 1976 in Valparaíso, Chile, war es ein Prozess, sich kolonialer Denkmuster bewusst zu werden. Es war das Heimweh, das sie zu Beginn ihres Lebens in Österreich vor 20 Jahren ins Schmetterlingshaus geführt hat, wo exotische Pflanzen wachsen und ihr die lebensgroßen Figuren, die eine indigene Familie aus dem Amazonas darstellen, aufgefallen sind. Bobadilla erzählt: „Ich habe angefangen mich zu fragen, was von mir ist schon hier?“
In Stein gemeißelt. Was kann man aus einer Stadt herauslesen, wenn man genauer hinsieht? „Die Stadt ist ein Konglomerat an Schichten, in der viele Generationen das heutige Wissen geprägt haben,“ so die Künstlerin.
Mittlerweile stehen wir vor einer ehemaligen Julius-Meinl-Filiale im ersten Bezirk. Dort wurden klassische Kolonialwaren verkauft, wie Kaffee, Reis und Gewürze. Österreich war immer verbunden mit Ländern, die Kolonien hatten, doch laut Bobadilla fehlt das Bewusstsein dafür, wie Österreich vom Kolonialismus profitiert hat.
Die Spuren der Kolonialzeit sind bis heute sichtbar, wie auf der Fassade der Ex-Meinl-Filiale. In mehreren Szenen wird auf dieser ein koloniales Narrativ erzählt. Die Bilder sind reliefartig eingearbeitet. Links ernten halbnackte Menschen den Kaffee. Auf dem mittleren Bild beladen Seefahrer das Schiff mit den befüllten Säcken. Auf dem letzten trinken die fein gekleideten Damen und Herren der Gesellschaft dann den Kaffee. Über den Szenen prangen herrschaftlich die Wappen der Hafenstädte Hamburg, Triest und London.
Neben uns bleibt eine Familie stehen, mit einer Kamera ausgerüstet, die Fassade wird für schön befunden und abgelichtet.
„Ich vermisse Aufklärung“, sagt Bobadilla. „Es wird hier zwar angedeutet, dass der Kaffee aus einem afrikanischen Land kommt, aber wie dieser angebaut wird, also wie die Arbeitsbedingungen für die Menschen sind, wird verschwiegen; oder welchen Stellenwert die Kultur des Kaffeetrinkens in afrikanischen Ländern hat.“

Julius Meinl, der ursprünglich aus Kraslice im heutigen Tschechien stammt, hat durch die Industrialisierung der Kaffeeröstung den Kaffee für viele Österreicher:innen leistbarer gemacht. Das Kaffeetrinken ist Teil der kulturellen Identität der Wiener:innen geworden. Das Bewusstsein über die koloniale Dimension der Kaffeekultur jedoch nicht.
Meinl hat das Logo zwar 2004 geändert, doch im alltäglichen Sprachgebrauch ist oft noch vom „Meinl-Mohr“ die Rede. Bobadilla hat bei einer U-Bahnfahrt erlebt, wie eine ältere Frau kritisierte: „Jetzt gibt es so viele Schwarze in Wien, vor Jahren war der Einzige der Meinl-Mohr.“ Die Leute hängen an ihren Traditionen, meint Bobadilla und spricht von den unsichtbaren Spuren, die sich in unsere Gedanken eingeschrieben haben – ein interner Kolonialismus.
Muster verlernen. Ziel der Spaziergänge ist es, koloniale Muster zu erkennen und zu verlernen. Von der ehemaligen Meinl-Filiale geht es weiter stadteinwärts. Stadtführerin Bobadilla gibt den Teilnehmer:innen Fragen mit auf den Weg, die beim nächsten Halt besprochen werden: „Wie hat sich Kolonialismus auf deine eigene Geschichte oder dein Wissen ausgewirkt? Was ist für dich klassische Musik oder Literatur und was gehört nicht dazu?“
Die Spaziergänge sind als offene Räume gedacht, in denen die Teilnehmer:innen auch ihre eigenen oder miterlebten Erfahrungen mit Rassismus teilen können. Nicht immer funktioniert das gleich gut. Bei den von Bobadilla angebotenen Spaziergängen im Gemeindebau kamen vor allem weiße Männer, die sich heroisierende Geschichten über den Widerstand im sozialen Wohnbau erwarteten. Der sogenannte „Indianerhof“ im 12. Bezirk hat seinen Namen von einer ca. 1,5 m großen Figur über dem Eingang. Weitere Figuren im Hof zeigen einen Schwarzen Menschen mit Bananen und Krokodil und einen weißen Menschen mit Büchern. Auf Auseinandersetzung mit rassistischen Stereotypen im Wiener Gemeindebau waren die Männer nicht vorbereitet und reagierten verärgert, da die Figuren mit den eigenen glücklichen Kindheitserinnerungen verbunden waren.
Bobadilla führt aus: „Jetzt wohnen dort hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund, die mit diesen Bildern konfrontiert sind und da sollten wir uns schon fragen, was macht das mit uns, wenn wir solche Bilder sehen?“
Sich anderer Kulturen zu bedienen, heißt nicht, sich für diese zu öffnen. Sie stellt Fragen, die nicht allen angenehm sind: „Woher kommt dieses Begehren nach dem Exotischen? Wodurch kommt diese Fernnostalgie?“ Bobadilla hofft, dass ein anderes Zusammenleben möglich ist, auch mit der Natur.
Monika Schneider-Mendoza arbeitet seit 2018 als Bildungsreferentin bei Südwind Niederösterreich und lernt außer Sprachen auch gerne Menschen kennen.
Infos zu Stadtspaziergängen und weiteren Projekten:
decolonizinginvienna.at
Berichte aus aller Welt: Lesen Sie das Südwind-Magazin in Print und Online!
- 6 Ausgaben pro Jahr als Print-Ausgabe und/oder E-Paper
- 48 Seiten mit 12-seitigem Themenschwerpunkt pro Ausgabe
- 12 x "Extrablatt" direkt in Ihr E-Mail-Postfach
- voller Online-Zugang inkl. Archiv
Mit einem Förder-Abo finanzieren Sie den ermäßigten Abo-Tarif und ermöglichen so den Zugang zum Südwind-Magazin für mehr Menschen.
Jedes Förder-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.
Mit einem Solidaritäts-Abo unterstützen Sie unabhängigen Qualitätsjournalismus!
Jedes Soli-Abo ist automatisch ein Kombi-Abo.